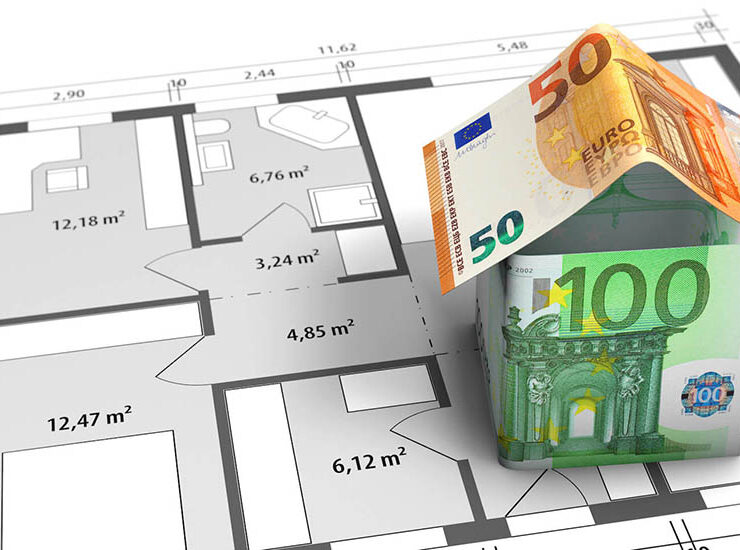Zinsprognose: Voraussichtliche Zinsentwicklung 2026
Viele Verbraucher:innen stehen Ende 2025 vor der Frage: „Soll ich jetzt einen Kredit aufnehmen oder besser noch abwarten?“ Wer die Zinsentwicklung wirklich verstehen will, sollte mehr kennen als nur den Leitzins.